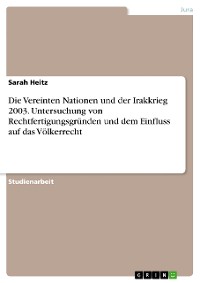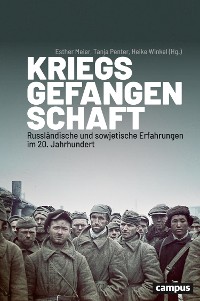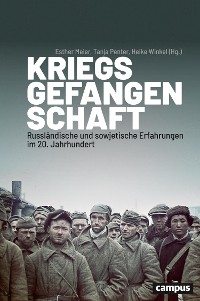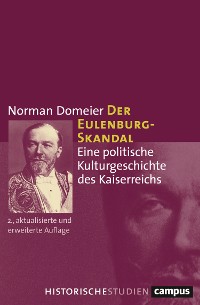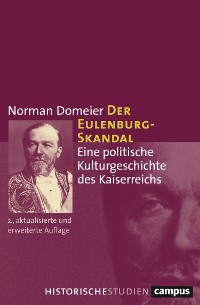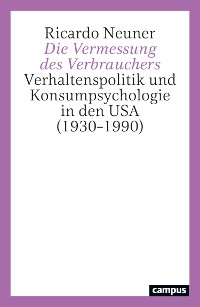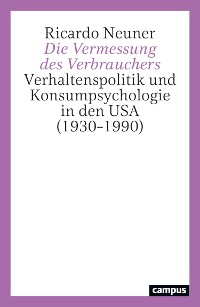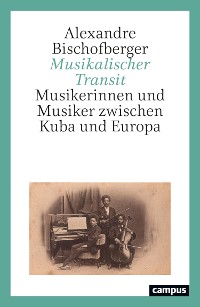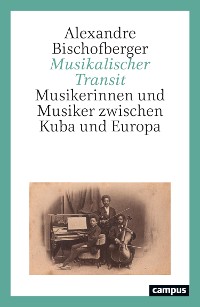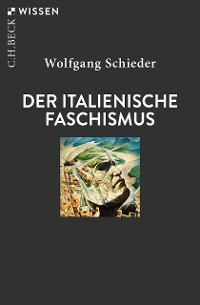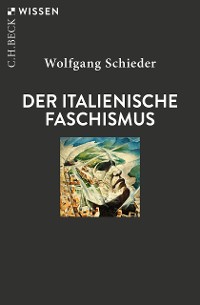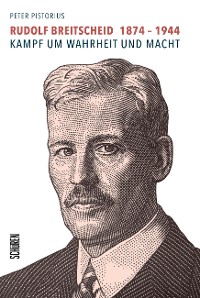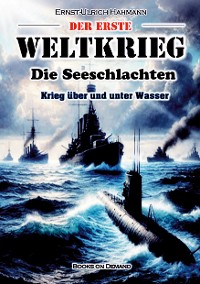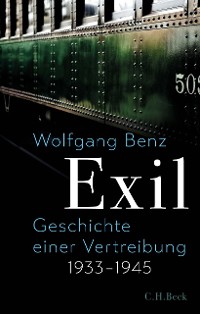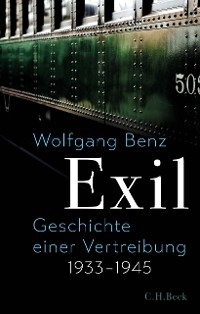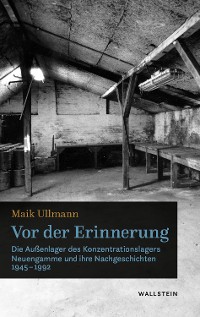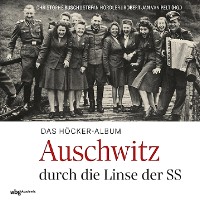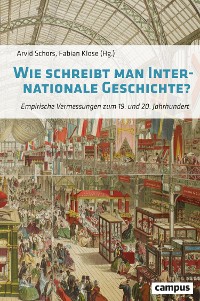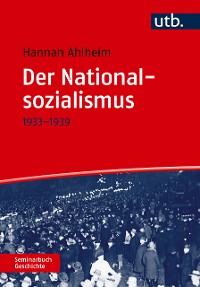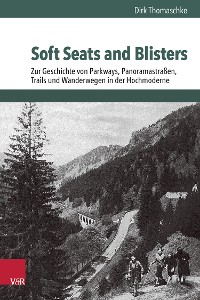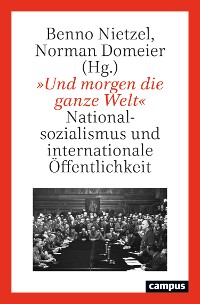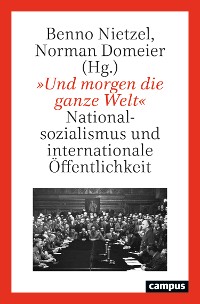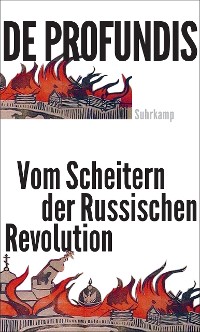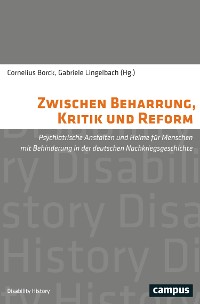Das Lüth-Urteil. Die Entwicklung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit und des Bundesverfassungsgerichts
Sarah Heitz
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / 20. Jahrhundert (bis 1945)
Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Note: 1,4, Universität Augsburg, Veranstaltung: Deutsche Verfassungsgeschichte 1849-1949, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Lüth-Urteil , der ersten „großen“ Grundrechtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wurden Auslegungsgrundsätze etabliert, die bis heute nicht nur maßgebend für die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur freien Meinungsäußerung (Art. 5 GG) sind, sondern seine komplette Grundrechtsauslegung geprägt haben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung nach Art. 5 GG wird dabei vom Bundesverfassungsgericht als unmittelbarster Ausdruck des Menschen in der Gesellschaft erachtet. Folglich geht das Bundesverfassungsgericht von einem weiten Meinungsbegriff aus, der nicht nur Inhalt und Form, sondern auch die Wirkungsabsicht der Meinungsäußerung schützt, ungeachtet der Tatsache, ob es sich bei der Aussage um eine Meinung, ein Werturteil, eine Stellungnahme oder eine meinungsbildende Tatsachenbehauptung handelt. In der Lüth-Entscheidung werden die Grundrechte „in erster Linie“ als „Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat“ formuliert. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wird als „für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend“ erachtet. Diese beiden Bedeutungselemente des Grundrechts, einerseits sein Individualrechtsgehalt als subjektives Recht und andererseits seine Funktion für die Ordnung des Gemeinwesens als objektives Recht, beschreiben den Doppelcharakter der Grundrechte und ihre umfassende Geltung. Durch das objektive Prinzip der Grundrechte, die „als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten“, entfalten diese unter anderem eine Ausstrahlungswirkung in das Privatrecht, welches in ihrem Geiste ausgelegt und angewendet werden muss. Die folgende Arbeit will nun die notwendigen Voraussetzungen aufzeigen, die diese differenzierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ermöglichten. Zunächst wird die historische Entwicklung der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit nachgezeichnet, welche die Grundlagen für die Einrichtung eines Verfassungsgerichts schuf. In einem zweiten Schritt werden die Vorläufer des Bundesverfassungsgerichts und weitere Einflüsse auf die Institution erläutert. Abschließend wird Stellung und Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts herausgestellt, sowie die Wirkung seiner Rechtsprechung bis heute resümiert.
Kundenbewertungen
königliche Gerichte, objektives Recht, Rheinbund 1806, Reichskammergerichtsordnung, Ausstrahlungswirkung der Grundrechte, Frankfurter Reichsverfassung, Drittwirkung, Entnazifizierung, Kaiserreich, Art. 5 GG, Erich Lüth, Grundgesetz, Verfassungsbeschwerde, Rechtsprechung, Grundrechtsentscheidungen, weiter Meinungsbegriff, subjektives Recht, Constitution of the United States of America, Marbury v. Madison 1803, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Supreme Court, Abwehrrechte des Bürgers, Normenkontrolle, Organstreitverfahren, Konstitutionalismus, Goldene Bulle, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Weimarer Reichsverfassung, Altes Reich, Wirkungsabsicht, Napoleon Bonaparte, Verfassungsgerichtsbarkeit, Verfassungshüter, Verfassungsauslegung, US Constitution, Verfassungskonvent Herrenchiemsee, Doppelcharakter der Grundrechte, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Staatsgerichtsbarkeit, Rechtsstaatlichkeit, Jud Süß, konstitutionelle Monarchie, Paulskirchen-Verfassung, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Reichskammergericht, Europäischer Gerichtshof, Individualrecht, Souveränität, Grundsatzentscheidung, Vorrang der Verfassung, Gemeinwesen, Werturteil, Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, objektive Wertordnung, Langzweitwirkung, Lüth-Entscheidung, Wechselwirkung, Ewiger Landfriede 1495, Veit Harlan